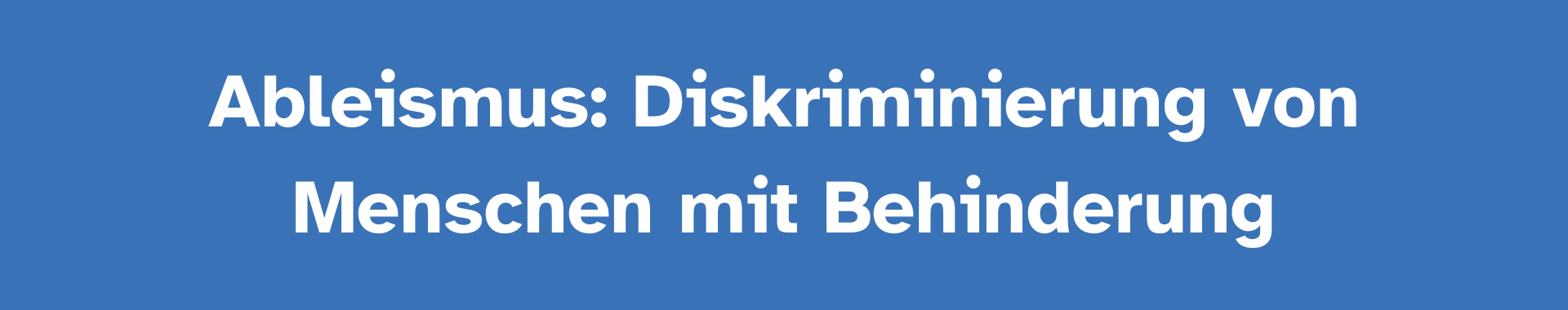In der praktischen wie auch sozialen Arbeit ist es wichtig, beide Schnittstellen, sowohl „Behinderung“ als auch „Migration“ differenziert zu behandeln und entsprechend für die eigene Inklusionsarbeit analysieren zu können. Ein geeignetes und von uns empfohlenes Analyseinstrument ist dabei die Intersektionalitätsforschung. Die sog. „Intersektionale Perspektivierung“ in der Betrachtung von Ungleichheits-, Differenz-, und Vielfaltkategorien nimmt eine immer zentralere Rolle in wissenschaftlichen Diskussionen, aber auch in zivilgesellschaftlich wirksamen Institutionen ein.
In Bezug auf Behinderung und Migration beleuchtet die intersektionale Perspektive, wie Menschen, die sowohl behindert als auch migrantisch sind, spezifischen Herausforderungen und Mehrfachdiskriminierungen ausgesetzt sein können. Beispielsweise kann eine behinderte Migrantin sowohl aufgrund ihrer Behinderung als auch wegen ihrer Migrationsgeschichte und möglicherweise auch ihres Geschlechts oder ihrer ethnischen Herkunft diskriminiert werden. Diese Mehrfachdiskriminierungen sind nicht einfach die Summe der einzelnen Diskriminierungen, sondern können neue, spezifische Probleme und Barrieren schaffen, die nur durch eine intersektionale Analyse vollständig verstanden werden können.
Die Bedeutung einer intersektionalen Perspektive liegt in der Fähigkeit, diese komplexen und miteinander verwobenen Machtstrukturen zu erkennen und anzugehen. Eine nicht-intersektionale Herangehensweise könnte die spezifischen Erfahrungen und Bedürfnisse von Menschen, die an mehreren Diskriminierungsachsen stehen, übersehen. Durch die Berücksichtigung der Intersektionalität können wir inklusivere und gerechtere Lösungen entwickeln, die die vielfältigen Erfahrungen und Herausforderungen aller Menschen berücksichtigen. Dies ist entscheidend für die Förderung von Gleichberechtigung und sozialer Gerechtigkeit in einer zunehmend vielfältigen Gesellschaft.