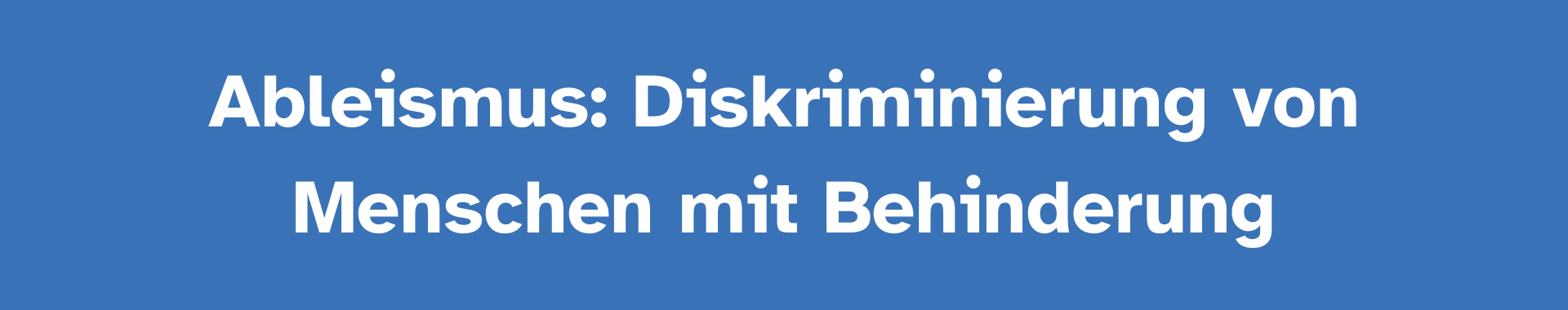In unserem Projekt „Mut zur Inklusion“ haben wir intensiv die Schnittstellen sowie Zusammenhänge, Herausforderungen und Potenziale der Themen Behinderung, Migration, Intersektionalität und Religion untersucht. Besonders im Kontext einer migrations- und diversitätssensiblen Arbeit sind diese Aspekte von besonderer Bedeutung. Im Folgenden möchten wir eine informative und prägnante Übersicht präsentieren und für eine differenzierte Sichtweise sensibilisieren.
Eine grundlegende Voraussetzung für die Beschäftigung mit diesen thematischen Schnittstellen ist das Verständnis der verwendeten Begriffe und deren Definition:
Behinderung
Der Begriff „Behinderung“ hat im Laufe der Zeit einen sehr wichtigen Wandel durchlaufen. Während früher ein stark medizinischer Blick auf Behinderung gelegt wurde und dieser damit eher als ein individuelles Defizit einer Person verstanden wurde, können wir heute beobachten, dass auch der Einfluss externer Faktoren aus der Umwelt als wirkmächtig in der Funktionsfähigkeit oder aber Einschränkung einer Person am öffentlichen Leben akzeptiert wird. Maßgeblich unterstützt wird dies durch die international anerkannte Definition von Behinderung durch die Weltgesundheitsorganisation, kurz die WHO. Diese beruft sich auf das biopsychosoziale Modell, sowie die darauf basierende internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF). Demnach sind die Funktionsfähigkeit, als auch eine Behinderung ein Ergebnis oder aber die Folge der komplexen Beziehung zwischen Mensch und Kontextfaktoren aus der Umwelt. Behinderung wird somit – und auf eben diesen Wandel deuteten wir bereits hin – weniger als statisches Merkmal oder personenbezogenes Defizit betrachtet, sondern vielmehr als dynamischer Prozess, der sich aus der komplexen Wechselwirkung unterschiedlicher Kontextfaktoren ergibt. Ein solches Verständnis von Behinderung hat auch Eingang in das deutsche Gesundheitssystem gefunden. So wurde die ICF als Maßstab in der Ermittlung von Bedarfen auch im Sozialgesetzbuch IX verankert. Für die Praxis bedeutet dies, dass alle Personen, die im Gesundheitsbereich tätig sind, dazu angehalten sind, sich mit Kontextfaktoren, welche förderlich oder aber hinderlich für die Funktionsfähigkeit oder Partizipation des jeweils betroffenen Menschen sein können, auseinanderzusetzen.
Trotz dieser erfreulichen Entwicklungen darf ein wesentlicher Kritikpunkt, der sich um die Feststellung des Anrechts auf sozialrechtliche Leistungen formuliert, nicht ignoriert werden. Hierfür wollen wir Vereine und Menschen, die behinderungssensible Arbeit machen oder machen wollen, einmal sensibilisieren:
Denn die tatsächliche Feststellung einer Behinderung wird in der Praxis wesentlich anhand medizinisch/psychiatrischer Gutachten erstellt und diese orientieren sich wiederum an der Versorgungsmedizinverordnung. Die Gewährleistung von Angeboten und Rechten wird weiterhin an weitestgehend veralteten Maßstäben gemessen, die dann wiederum überholte Betrachtungsweisen von Behinderung reproduzieren können. Die Folge: Strukturelle Dimensionen sowie entsprechende Barrieren, die maßgeblich durch Kontextfaktoren beeinflusst werden, bleiben überwiegend unberücksichtigt.
Migration
Bei dem Begriff „Migration“ handelt es sich grundsätzlich um eine rein deskriptive Beschreibung vielfältiger sowie unterschiedlicher Wanderungsphänomene, unter denen die Arbeitsmigration, die Heiratsmigration oder aber Migration aufgrund von Flucht und Vertreibung gezählt werden kann. Im Rahmen diversitätssensibler Projekte, aber auch im Kontext gesellschaftlicher Fragestellungen, gerät die Begriffsbeschreibung „Migrationshintergrund“ in den tatsächlichen Arbeitsfokus, besonders für Vereine und Menschen, die im Kontext einer migrationssensiblen Arbeit tätig sind oder sein wollen. Trotz des schwierigen Unterfangens, diesen Begriff exakt zu definieren, hat das statistische Bundesamt einen ersten Versuch unternommen und folgende Definition des Begriffes aufgestellt. Das Statistische Bundesamt definiert Menschen mit Migrationshintergrund als jene, die nach 1949 in das heutige Gebiet der BRD zugewandert sind, sowie alle in Deutschland geborenen Ausländer und alle in Deutschland als Deutsche Geborenen mit zumindest einem nach 1949 zugewanderten oder als Ausländer in Deutschland geborenen Elternteil. Diese Definition betont die Nationalität und schließt andere Formen der Migration aus. Es ist wichtig, dass Vereine und Menschen in der Sozialarbeit diesen Aspekt kritisch hinterfragen und eine breitere Perspektive einnehmen.
Zusammenfassend zeigt die praktische Arbeit an den Schnittstellen von Behinderung und Migration eine starke Fokussierung auf personenbezogene Ausgangslagen bei Behinderung und eine auf Nationalität beschränkte Diskussion bei Migration. Diese Ausgangslage basiert auf jahrelanger Sozialarbeit mit einem solchen Fokus und muss in Zukunft weiter ausdifferenziert werden, wie unser Verein fordert.